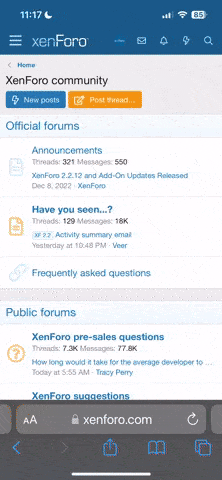KHH
- Beiträge
- 2.282
Re: Kommt mir bekannt vor!
"Die Bilder mit dem Schimmel kommen mir in sofern bekannt vor, als dass wir bereits einige Stampflehmwände mit Stroh im Erdgeschoss errichtet haben, und die sind während des Trockenprozesses tatsächlich auch geschimmelt und sahen ganz ähnlich aus. Nach Abschluss der Trocknung war der Schimmelpilz aber hinüber und kam auch nicht wieder."
Die Fotos sind Aufnahmen von außen, nach Ausbau der Ausfachungen. Von innen sah man an der Wand nichts auffälliges. Der Schaden fiel auf weil nach jedem stärkeren Regenguss in einem Raum im EG Wasser aus der Wand lief. Auf der Suche nach der Eintrittstelle landeten wir ungefähr in Brüstungshöhe im OG. Dort konnten wir an mehreren Gefachen den Außenputz als gefachgroße Scheiben (am Stück) abnehmen und die dahinter liegende Lehmsteinausmauerung mit "kleinem Besteck" raus kratzen. Sie war über die Jahre wegen permanenter Durchfeuchtung völlig vom Frost zerstört. Als Folge von zu viel Wassereintrag und viel zu langer Rücktrockungszeit.
Die Aufnahme zeigt nur eines von 10 -15 verschimmelten Gefachen, verteilt über 2 innenliegende Räume.
Die Strohleichtlehm-Innenschalen waren ca. 20 cm dick, in jedem Raum hing ein großer Heizkörper an der Wand.
Beide Räume waren Kinderzimmer, also permanent genutzt und geheizt.
Die Ausrichtung der Wand ist nach Westen, von wo Wind und Regen her kommen.
Das Wasser drang durch die offenen Anschlussfugen ein und lief eben nicht mehr unten wieder raus, weil die Innenschale es aufgesaugt und nach lokaler Sättigung nach unten, durch die Decke durch, weitergeleitet hat, ohne dass es zunächst sichtbar wurde.
Zur Klarstellung: Ich stelle eine Strohleichtlehm-Innenschale nicht grundsätzlich in Frage. Es ist eine traditionelle, lange praktizierte, deshalb anerkannte Art eine Innendämmung herzustellen.
Ich weiße nur auf Risiken und mögliche Schäden hin, die durch diese Bauweise auftreten/auftreten können.
Die überwiegende Mehrzahl solcher Innenschalen funktionieren vermutlich schadlos. Jedenfalls habe ich diesbezüglich noch nichts negatives gehört/gelesen.
Nichtsdestrotz ist es eine veraltete Bauweise, die nach heutigem Standard uneffektiv ist.
M. M. n. macht es wenig Sinn an Altem festzuhalten wenn das Neue in jeder Hinsicht besser ist.
"Besser" im Sinne von
- besserem Dämmwert,
- besserer kap. Leitfähigkeit,
- einfacherer und schnellerer Verarbeitung,
- festerer Konsistenz, damit einfacheres Befestigen/Aufhängen von Gegenständen (z. B: Wandheizung,
Gardinen, Regale, Bilder, usw.),
- wesentlich schnellere Fertigstellung (Bezug der Räume), die Trocknung einer 20cm-Strohleichtlehm-Innenschale dauert ca. 6 - 10 Wochen)
- wesentlich geringeres Risiko versteckt auftretender Schäden.
Das A und O einer funktionierenden Innendämmung auf einer Fachwerkwand ist ihre äußere Dichtigkeit gegen Schlagregen und Kaltluft. So lange von außen in eine Fw-wand kein Regenwasser eindringen kann (weil sie dicht ist, weil der Dachüberstand groß genug ist, weil es die wetterabgewandte Seite ist....), wird eine hohlraumfreie, kapillar leitfähige und diffusionsoffene Innendämmung funktionieren, egal aus was sie ist. Selbst wenn sie rein rechnerisch etwas überdimensioniert ist.
"Mit dem Thema Strohleichtlehm bin ich jetzt noch nicht ganz durch, sondern muss gut überlegen. Z.B. ob ich den Lehmanteil dann nicht doch noch ein wenig erhöhe für die Kapillaraktivität, und auch über die letztendliche Dicke (in Büchern zu dem Thema wird irgendwie stets 15cm empfohlen)."
Die Erhöhung des Lehmanteils bedeutet eine Reduzierung/Verschlechterung des Dämmwertes.
Die Dicke wird mit zunehmendem Maße kritischer, weil die Trocknung umso länger dauert. Die besagten 15 cm sind ein Grenzwert, bei dem das Risiko von Schimmelwuchs und/oder beginnender Verrottung noch einigermaßen handhabbar ist.
"Gibt es Ihres Wissens nach noch Dämmstoffe mit höherer Kapillaraktivität als HWF-Platten?"
Das weiß ich nicht. Es gibt von Herstellerseite so gut wie keine Angaben zur Kapillarität ihrer Produkte.
Wie kapillaraktiv ein Dämmstoff ist hängt in erster Linie von seiner Herstellung, bzw. ihr innerer Aufbau als fertiges Produkt ab, weniger vom Ausgangsstoff. Beispiel 1 Mineralschaumplatten sind ebenfalls hoch kapillaraktiv. Der Stein aus dem sie gemacht werden, eher nicht. Beispiel 2: Strohhalme sind nur längs, in Faserrichtung, kapillar leitfähig, klein gehäckselt und zu Dämmplatten gepresst, in alle Richtungen. Beispiel 3: Blähton ist sowohl im Urzustand (roher, fester Ton) als auch als gebranntes Produkt kapillar leitfähig.
"...., sonst heize ich den Raum doch lieber von innen als mit einer Wandheizung zur Hälfte den Garten."
Das ist ein Trugschluss. Der Wärmeverlust durch eine schlecht gedämmt Wand bleibt der gleiche, egal wie, d. h., "von wo" der entsprechende Raum geheizt wird.
Umgekehrt macht es wenig Sinn eine Wandheizung an eine Innenwand zu installieren, wenn die Außenwand
"kalt" in den Raum strahlt. Das Empfinden der "kalten" Strahlung bewirkt, dass man die Raumtemperatur erhöht. Schon allein deshalb sollte man eine Außen- od. Innendämmung anbringen. Man kann die Raumtemp. um 1, 2, 3 K senken ohne dass es ungemütlich wird.
Thema "Feuchtewanderung"
Es geht nicht darum, dass Feuchtigkeit über mehrere Etagen nach oben wandert (was fatal wäre...), sondern dass im EG keine Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Wand und Innenschale eindringt.
"Ich hatte die Sperre auch vor, aber eher weil ich dachte, dass das Wasser im Strohleichtlehm sonst nach unten in die Fassade läuft"
Welches Wasser?
" Warum wäre es denn so schlimm wenn Wandfeuchte vom EG ins OG käme und dann dort abtrocknete (wo Sonne und Wandheizung dies unterstützten)? "
Weil dir derweil im EG die Hütte weg fault. Um es mal ganz platt auszudrücken.
Diese Frage impliziert, dass du dich unbedingt mehr mit der Materie befassen musst!!!
Gruß,
KH
"Die Bilder mit dem Schimmel kommen mir in sofern bekannt vor, als dass wir bereits einige Stampflehmwände mit Stroh im Erdgeschoss errichtet haben, und die sind während des Trockenprozesses tatsächlich auch geschimmelt und sahen ganz ähnlich aus. Nach Abschluss der Trocknung war der Schimmelpilz aber hinüber und kam auch nicht wieder."
Die Fotos sind Aufnahmen von außen, nach Ausbau der Ausfachungen. Von innen sah man an der Wand nichts auffälliges. Der Schaden fiel auf weil nach jedem stärkeren Regenguss in einem Raum im EG Wasser aus der Wand lief. Auf der Suche nach der Eintrittstelle landeten wir ungefähr in Brüstungshöhe im OG. Dort konnten wir an mehreren Gefachen den Außenputz als gefachgroße Scheiben (am Stück) abnehmen und die dahinter liegende Lehmsteinausmauerung mit "kleinem Besteck" raus kratzen. Sie war über die Jahre wegen permanenter Durchfeuchtung völlig vom Frost zerstört. Als Folge von zu viel Wassereintrag und viel zu langer Rücktrockungszeit.
Die Aufnahme zeigt nur eines von 10 -15 verschimmelten Gefachen, verteilt über 2 innenliegende Räume.
Die Strohleichtlehm-Innenschalen waren ca. 20 cm dick, in jedem Raum hing ein großer Heizkörper an der Wand.
Beide Räume waren Kinderzimmer, also permanent genutzt und geheizt.
Die Ausrichtung der Wand ist nach Westen, von wo Wind und Regen her kommen.
Das Wasser drang durch die offenen Anschlussfugen ein und lief eben nicht mehr unten wieder raus, weil die Innenschale es aufgesaugt und nach lokaler Sättigung nach unten, durch die Decke durch, weitergeleitet hat, ohne dass es zunächst sichtbar wurde.
Zur Klarstellung: Ich stelle eine Strohleichtlehm-Innenschale nicht grundsätzlich in Frage. Es ist eine traditionelle, lange praktizierte, deshalb anerkannte Art eine Innendämmung herzustellen.
Ich weiße nur auf Risiken und mögliche Schäden hin, die durch diese Bauweise auftreten/auftreten können.
Die überwiegende Mehrzahl solcher Innenschalen funktionieren vermutlich schadlos. Jedenfalls habe ich diesbezüglich noch nichts negatives gehört/gelesen.
Nichtsdestrotz ist es eine veraltete Bauweise, die nach heutigem Standard uneffektiv ist.
M. M. n. macht es wenig Sinn an Altem festzuhalten wenn das Neue in jeder Hinsicht besser ist.
"Besser" im Sinne von
- besserem Dämmwert,
- besserer kap. Leitfähigkeit,
- einfacherer und schnellerer Verarbeitung,
- festerer Konsistenz, damit einfacheres Befestigen/Aufhängen von Gegenständen (z. B: Wandheizung,
Gardinen, Regale, Bilder, usw.),
- wesentlich schnellere Fertigstellung (Bezug der Räume), die Trocknung einer 20cm-Strohleichtlehm-Innenschale dauert ca. 6 - 10 Wochen)
- wesentlich geringeres Risiko versteckt auftretender Schäden.
Das A und O einer funktionierenden Innendämmung auf einer Fachwerkwand ist ihre äußere Dichtigkeit gegen Schlagregen und Kaltluft. So lange von außen in eine Fw-wand kein Regenwasser eindringen kann (weil sie dicht ist, weil der Dachüberstand groß genug ist, weil es die wetterabgewandte Seite ist....), wird eine hohlraumfreie, kapillar leitfähige und diffusionsoffene Innendämmung funktionieren, egal aus was sie ist. Selbst wenn sie rein rechnerisch etwas überdimensioniert ist.
"Mit dem Thema Strohleichtlehm bin ich jetzt noch nicht ganz durch, sondern muss gut überlegen. Z.B. ob ich den Lehmanteil dann nicht doch noch ein wenig erhöhe für die Kapillaraktivität, und auch über die letztendliche Dicke (in Büchern zu dem Thema wird irgendwie stets 15cm empfohlen)."
Die Erhöhung des Lehmanteils bedeutet eine Reduzierung/Verschlechterung des Dämmwertes.
Die Dicke wird mit zunehmendem Maße kritischer, weil die Trocknung umso länger dauert. Die besagten 15 cm sind ein Grenzwert, bei dem das Risiko von Schimmelwuchs und/oder beginnender Verrottung noch einigermaßen handhabbar ist.
"Gibt es Ihres Wissens nach noch Dämmstoffe mit höherer Kapillaraktivität als HWF-Platten?"
Das weiß ich nicht. Es gibt von Herstellerseite so gut wie keine Angaben zur Kapillarität ihrer Produkte.
Wie kapillaraktiv ein Dämmstoff ist hängt in erster Linie von seiner Herstellung, bzw. ihr innerer Aufbau als fertiges Produkt ab, weniger vom Ausgangsstoff. Beispiel 1 Mineralschaumplatten sind ebenfalls hoch kapillaraktiv. Der Stein aus dem sie gemacht werden, eher nicht. Beispiel 2: Strohhalme sind nur längs, in Faserrichtung, kapillar leitfähig, klein gehäckselt und zu Dämmplatten gepresst, in alle Richtungen. Beispiel 3: Blähton ist sowohl im Urzustand (roher, fester Ton) als auch als gebranntes Produkt kapillar leitfähig.
"...., sonst heize ich den Raum doch lieber von innen als mit einer Wandheizung zur Hälfte den Garten."
Das ist ein Trugschluss. Der Wärmeverlust durch eine schlecht gedämmt Wand bleibt der gleiche, egal wie, d. h., "von wo" der entsprechende Raum geheizt wird.
Umgekehrt macht es wenig Sinn eine Wandheizung an eine Innenwand zu installieren, wenn die Außenwand
"kalt" in den Raum strahlt. Das Empfinden der "kalten" Strahlung bewirkt, dass man die Raumtemperatur erhöht. Schon allein deshalb sollte man eine Außen- od. Innendämmung anbringen. Man kann die Raumtemp. um 1, 2, 3 K senken ohne dass es ungemütlich wird.
Thema "Feuchtewanderung"
Es geht nicht darum, dass Feuchtigkeit über mehrere Etagen nach oben wandert (was fatal wäre...), sondern dass im EG keine Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Wand und Innenschale eindringt.
"Ich hatte die Sperre auch vor, aber eher weil ich dachte, dass das Wasser im Strohleichtlehm sonst nach unten in die Fassade läuft"
Welches Wasser?
" Warum wäre es denn so schlimm wenn Wandfeuchte vom EG ins OG käme und dann dort abtrocknete (wo Sonne und Wandheizung dies unterstützten)? "
Weil dir derweil im EG die Hütte weg fault. Um es mal ganz platt auszudrücken.
Diese Frage impliziert, dass du dich unbedingt mehr mit der Materie befassen musst!!!
Gruß,
KH